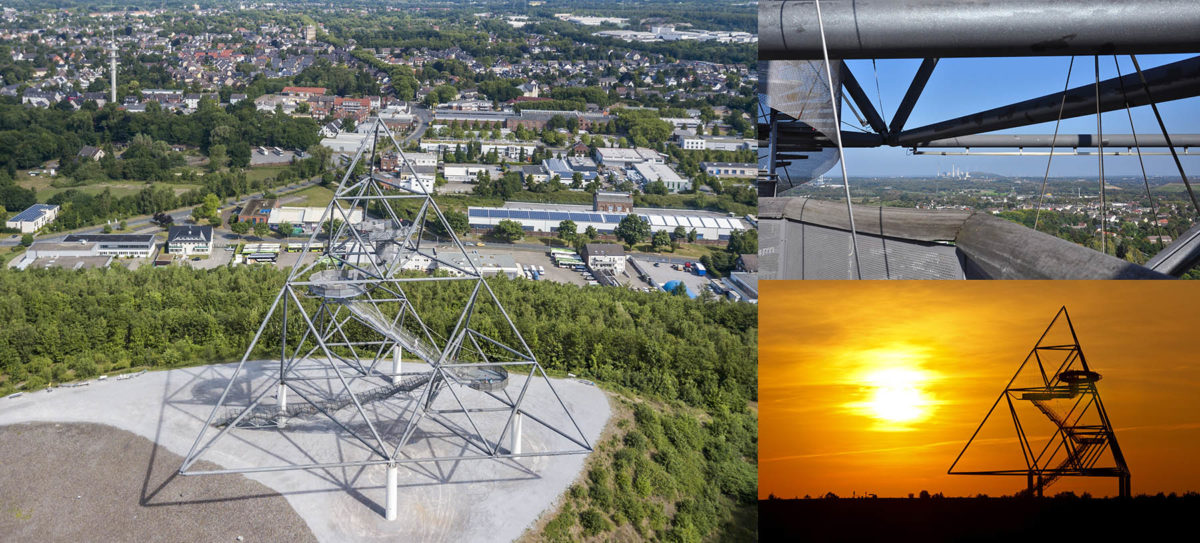DAMALS:
Der Bau des Stadions zwischen 1924 und 1926 wurde vorwiegend von Arbeitslosen im Rahmen von Notstandsarbeiten durchgeführt. Das Stadion wurde mit zwei Veranstaltungen eröffnet: Am 6. Juni 1926 eröffneten die bürgerlichen Sportler die Kampfbahn, eine Woche später fand eine Veranstaltung der Arbeiter-Turner statt. Am 4. September 1927 fand im Stadion und in der angrenzenden Westfalenhalle der Deutsche Katholikentag statt. Diese Veranstaltung wurde vom Apostolischen Nuntius des Papstes in Deutschland, Eugenio Pacelli, der später als Pius XII. Papst wurde, geleitet. 1929 wurde das Viertelfinalspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1928/29 zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC im Stadion ausgetragen. Die Hertha aus Berlin gewann das Spiel mit 4:1 Toren. 1932 war die Kampfbahn Austragungsort für das Reichstreffen der Deutschen Jugendkraft und den Reichskriegertag. Nach seiner Eröffnung war es ab 1937 bis zur Eröffnung des Westfalenstadions 1974 die Heimat von Borussia Dortmund. Zwischenzeitlich verfügte die „Kampfbahn“ in den 1960er Jahren aufgrund einer zusätzlich aufgebauten Holz-Stehtribüne über eine Kapazität von 42.000 Zuschauern.
HEUTE:
Heute ist es ein Leichtathletik-Stadion mit einer Kapazität von 25.000 Zuschauern, mit 3.000 überdachten Sitzplätzen und 7.000 Stehplätzen. Es dient den Dortmunder Vereinen wie LG Olympia Dortmund, LAC Dortmund, LC Rapid Dortmund und TuS Westfalia Hombruch als Trainings- und Wettkampfstätte. Des Weiteren wird es als Spielstätte von der zweiten Herrenmannschaft von Borussia Dortmund genutzt; dann sind 9.999 Zuschauer zugelassen, davon 3.000 auf Sitzplätzen. In der Saison 2009/10, als die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga spielte, diente das Stadion Rote Erde als Spielstätte der Mannschaft, obwohl es den Anforderungen des DFB nicht entsprach. Die Regularien für die 3. Liga sehen eine Lichtstärke von 800 Lux vor, die Flutlichtanlage des Stadions ergibt aber nur eine Lichtstärke von 586 Lux. Dennoch war das Stadion nach dem Wiederaufstieg der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund auch zwischen 2013 und 2015 Spielstätte in Liga 3.
STANDORT:
Strobelallee 50
44139 Dortmund